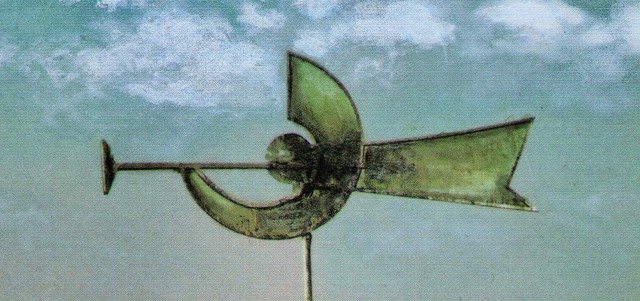
Klostergeschichte
Vier Minuten Gerleve

Vier Minuten Gerleve
In vier Minuten erfahren Sie alles Wichtige über die Geschichte und die Aufgaben der Abtei.
Die Anfänge

Die Anfänge
Die Anfänge des Klosters gehen zurück in das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Die Geschwister Bernhard, Elisabeth und Hermann Wermelt besaßen in Gerleve einen Bauernhof. Da sie ohne Erben blieben, wollten sie ihn zur Gründung eines Klosters stiften. Die Benediktiner der Erzabtei Beuron nahmen das Angebot an. Sie stellten die Neugründung unter das Patronat des hl. Joseph. Am 19. September 1899 trafen die ersten Mönche auf dem Wermelthof ein. Sie übernahmen die Landwirtschaft, feierten in einer kleinen Hauskapelle die Gottesdienste und unterstützten die Pfarrer der Umgebung bei ihrer Arbeit.
Der Bau des Klosters

Der Bau des Klosters
P. Ludger Wilhelm Rincklake OSB (1851 – 1927) entwarf die Pläne für das neue Kloster und seine Kirche. Die unzureichende finanzielle Ausstattung der Neugründung und die politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts verhinderten bis heute die volle Realisierung des Rincklake-Plans. Immerhin konnte die Kirche seit dem 10. Juni 1904 als Gottesdienstraum genutzt werden. Ihre feierliche Weihe erfolgte jedoch erst 1950. Ebenfalls im Juni 1904 wurde der Westflügel des Klosters bezogen. Die Fertigstellung des Klosterbaus dauerte noch bis 1960.
Erhebung zur Abtei

Erhebung zur Abtei
Mit dem Einzug der Mönche in das neue Kloster 1904 erfolgte die Erhebung der gerade einmal fünf Jahre alten Neugründung zur selbstständigen Abtei. Erster Abt wurde 1906 P. Raphael Molitor (1873 – 1948) aus Beuron. Unter seiner Leitung erlebte das Kloster einen rasanten Aufschwung. 1936 gehörten ihm 100 Mönche an. Der Landwirtschaftsbetrieb, der damals einen entscheidenden Beitrag zur Versorgung der Mönche liefern mußte, wurde ständig modernisiert. In verschiedenen Bereichen bildete die Abtei Lehrlinge aus. Zeitweilig führte sie eine kleine Schule und ein Internat in Coesfeld. Großen Wert legte Abt Molitor auf die wissenschaftliche Ausbildung geeigneter Mönche. Einige von ihnen erlangten als Theologen, Historiker oder Musikwissenschaftler hohes Ansehen. Mehrere übernahmen Lehrstühle an der römischen Benediktinerhochschule S. Anselmo. Zugleich verstärkte die zahlenmäßig gewachsene Kommunität ihren Seelsorgeeinsatz. Das neben dem Kloster errichtete Hotel wurde zum Exerzitienhaus Ludgerirast. 1928 kam ein eigenes Jugendgästehaus hinzu. Seit 1918 entwickelte sich Gerleve zum wichtigsten Zentrum der »Liturgischen Bewegung« im Nordwesten Deutschlands. 1937 folgte der Konvent einem Wunsch von Papst Pius XI. (1857 – 1939) und beteiligte sich durch wissenschaftliche Forschung und Öffentlichkeitsarbeit an dem Projekt, die Wiedervereinigung der russisch-orthodoxen und der katholischen Kirche zu erreichen.
Vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg

Vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg
Im Ersten Weltkrieg fielen fünf junge Mitbrüder der Abtei an der Front. Die Weimarer Republik 1918 bis 1933 brachte den Ordensgemeinschaften mehr Freiheit von staatlicher Beaufsichtigung. Andererseits entstanden für die Klöster wie für die gesamte Bevölkerung durch die Geldentwertung und dann durch die französisch-belgische Ruhrbesetzung 1923 bis 1925 schwere wirtschaftliche Herausforderungen. Die Gerlever Mönche vermieden politische Stellungnahmen in der Öffentlichkeit. Diesen Kurs versuchten sie auch nach Hitlers Machtergreifung 1933 beizubehalten. Der für viele Katholiken offenkundige Unrechtscharakter des neuen Regimes trug rasch dazu bei, die Zahl der Gottesdienstbesucher zu steigern. Die betonte Herausstellung christlicher Werte in Gerleve wurde sowohl von den Gläubigen wie von den Nationalsozialisten als Widerstand verstanden.
Im Zuge des nationalsozialistischen »Klostersturms«, gegen den der Bischof von Münster Clemens August von Galen (1878–1946) in einigen Predigten scharf protestierte, erfolgte auch die Aufhebung der Abtei Gerleve. Am 13. Juli 1941 wurden die Gerlever Mönche gezwungen, ihr Kloster zu verlassen. Da kein anderes kirchliches Haus in der Lage war, so viele Mönche über längere Zeit aufzunehmen, verteilten sich die Mönche auf verschiedene, meist kirchliche Häuser in ganz Deutschland. Zwei Patres wurden in das Konzentrationslager Dachau deportiert. 25 Gerlever Mönche mußten den Militärdienst ableisten. Acht von ihnen fielen im Krieg, zwei gelten seither als vermisst.
Die Nationalsozialisten nutzten das Haus Ludgerirast für die Hitlerjugend. Schwangere Frauen aus dem vom Luftkrieg betroffenen Ruhrgebiet und aus Münster sollten sich im leerstehenden Kloster auf die Entbindung ihrer Kinder vorbereiten und gebären können. Damals wurden in Gerleve mehr als 800 Kinder geboren. Im Februar 1945 richtete die Wehrmacht im Kloster ein Lazarett ein, das die Amerikaner nach der Befreiung übernahmen Aufgenommen wurden nun auch zwangsverschleppte Russen (Displaced Persons). Viele von ihnen starben und sind auf dem Klosterfriedhof begraben.
Neue Aufgaben

Neue Aufgaben
Erst am 23. Mai 1946 konnten die Mönche in ihr Kloster zurückkehren. Abt Molitor starb am 14. Oktober 1948. Sein Nachfolger Abt Pius Buddenborg (1902—1987) setzte neue Akzente. Die wissenschaftliche Ausrichtung des Konvents wurde beibehalten. Dagegen entfiel das gemeinsame Engagement für die Ökumene mit der Ostkirche. Neben die Exerzitienarbeit trat immer stärker die Jugendseelsorge, für die 1952 ein modernes Gästehaus errichtet wurde, das 1973 und 1984 durch zwei Neubauten mit Platz für mehr als 70 Personen ersetzt wurde.
Die vom Zweiten Vatikanischen Konzil (1962—1965) eingeleiteten kirchlichen Reformen setzten die Gerlever Mönche aufgeschlossen, aber auch mit Augenmaß um. Die Priester feierten die Messe seitdem in der Form der Konzelebration. Viele Texte der Liturgie konnten nun in deutscher Sprache gebetet oder vorgetragen werden. Sorgsam achteten die Mönche jedoch darauf, die Gregorianischen Gesänge zu erhalten. Besuche der Gerlever Gottesdienste sind für viele Menschen ein großes Erlebnis.
Abt Buddenborgs Nachfolger Abt Clemens Schmeing (geb. 1930) seit 1971 und Abt Pius Engelbert (geb. 1936) seit 1999 setzten den Kurs ihres Vorgängers fort. Abt Schmeing entließ das 1951 von Gerleve gegründete Priorat Nütschau bei Lübeck in die Selbstständigkeit. Für den Ausbau der Gästehäuser gewann er den später weltberühmten Architekten Josef Paul Kleihues (geb. 1933). Im Jubiläumsjahr 2004 zählt der Konvent 52 Mönche. Noch immer ändern sich die Aufgabenfelder der Gemeinschaft. Auf die landwirtschaftliche Arbeit musste inzwischen fast ganz verzichtet werden. Statt dessen kamen neue Formen der Seelsorge- und Bildungsarbeit auf. Zuletzt führte Abt Pius Engelbert das »Forum Gerleve« ein. Unter diesem Namen finden mehrmals im Jahr öffentliche Vorträge und Konzerte statt.
Nach dem Ende der Amtszeit von Abt Pius Engelbert wählte der Konvent am 5. Dezember 2006 P. Laurentius Schlieker zum Prior-Administrator für drei Jahre und am 24. August 2009 zum Abt. Ende 2008 entstand die »Stiftung Abtei Gerleve« zur Unterstützung der Aufgaben der Abtei. Ferner konnte 2015 der Neubau von Haus I unserer Jugendbildungsstätte »Haus St. Benedikt« eingeweiht werden. Am 19. April 2020 gab Abt Laurentius sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich die Wahl seins Nachfolgers um einige Monate. Aus der Wahl am 15. August 2020 ging P. Andreas Werner als sechster Abt von Gerleve hervor.